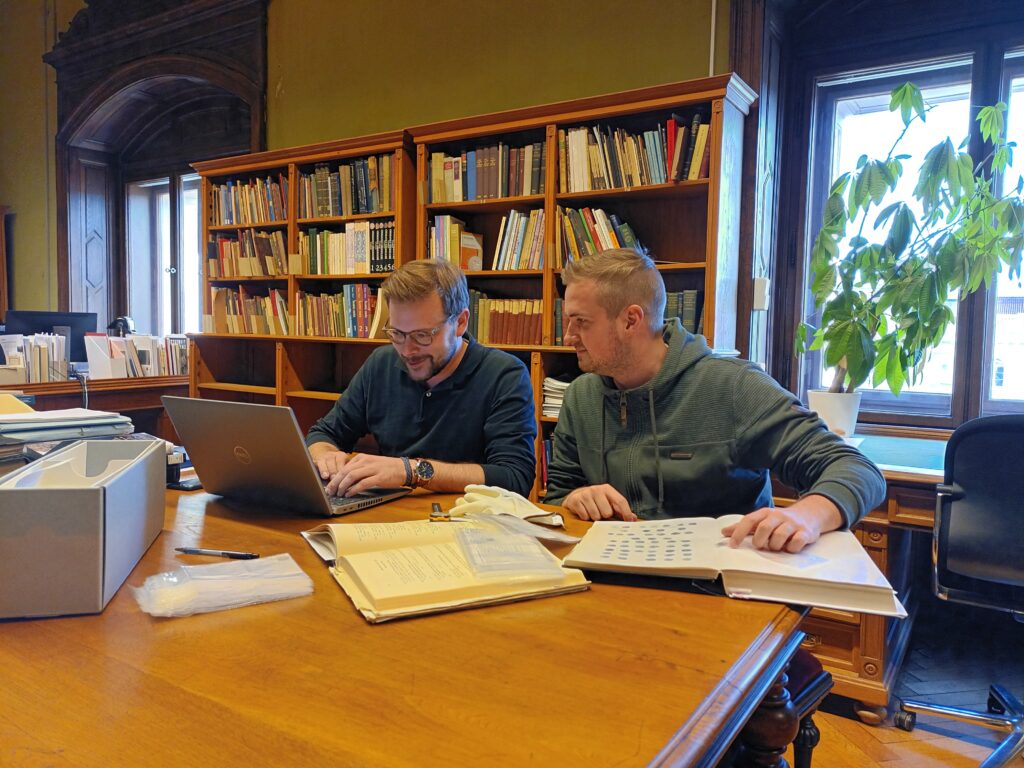Ende März 2025 erfolgte, durch Vermittlung des Münzkabinetts des Kunsthistorischen Museums, die Meldung einer spätmittelalterlichen Fundmünze aus Kärnten an das Bundesdenkmalamt. Bei dem Altfund, der bereits im Sommer 1971 in Wiederschwing, Gemeinde Stockenboi (PB Villach Land) gemacht worden ist, handelt es sich um einen ungarischen Goldgulden König Sigismunds (1387–1437), der nun erstmalig erfasst, und der Wissenschaft zugänglich gemacht werden konnte.


Die Vorderseite zeigt ein geviertes Wappen mit den Árpádenstreifen und dem Böhmischen Löwen. In der Umschrift wird Sigismund als König Ungarns genannt. Auf der Rückseite ist der heilige Ladislaus mit Nimbus dargestellt, in der Rechten eine Streitaxt, in der Linken einen Reichsapfel haltend, der Schriftzug gibt den Namen des Heiligen wider. Seitlich sind die Zeichen des zuständigen Kammergrafen Nikolaus von Redewitz angebracht, ein unziales h sowie ein Kreuzschild, wodurch die Münze auf die Jahre 1430/31 datiert und der Münzstätte Nagybánya zugewiesen werden kann.
Gefunden wurde die Goldmünze auf einem alten Hofareal, beim Aushub eines Kellers für einen Neubau in den 1970er Jahren. Zu dem Grundstück gehört auch eine alte Kapelle, die heute anderwertig in Verwendung ist. Ob der Sakralbau in die Zeit des 15. Jahrhunderts zurückreicht, und ob hier ein Zusammenhang mit der Fundmünze besteht ließ sich noch nicht klären (Stichwort: Münzen im sakralen Kontext).
Der 1430/31 in Nagybánya (heute Baia Mare, Rumänien) geprägte Goldgulden König Sigismunds gehört zu jenen Goldmünzen, die seit den dreißiger Jahren des 14. Jahrhunderts von Ungarn aus in das Gebiet des heutigen Österreichs vordrangen. Die seit dem späten 13. Jahrhundert steigenden Bedürfnisse von Handel und Wirtschaft verlangten immer mehr nach einem fein differenzierten Nominalsystem; der bisweilen ausgeprägte kleine Pfennig des Mittelalters reichte für große überregionale Geldgeschäfte nicht mehr aus. Als Reaktion darauf kam es zur Einführung von Mehrpfennignominalen wie dem Groschen in Silber. Die norditalienischen Städte prägten aber auch Goldmünzen, so wie Genua und Florenz ab 1252 bzw. Venedig ab 1284. In gesamt Europa breiteten sich der sog. Floren und Dukat als Handelsmünze rasant aus und der daraufhin auch vielerorts Nachahmung fand.
In Österreich wurde weiterhin der Pfennig geprägt, für den überregionalen Handel verwendete man die ausländischen Großnominale. Das waren ab dem 14. Jahrhundert der in Kuttenberg geprägte Prager Groschen sowie der ungarische Goldgulden, der ab den 1330er Jahren für den österreichischen Raum relevant wurde. Ungarn hatte 1325 – also nur kurz zuvor – begonnen, Goldmünzen nach Florentiner Vorbild auszuprägen. Knapp danach strömten diese mit dem überregionalen Handel in den österreichischen Raum und gewannen hier stark an Bedeutung. In diesem wirtschafts- und geldhistorischen Kontext am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit fällt nun auch der ungarische Goldgulden aus Kärnten.
Diese Situation Ende des Spätmittelalters lässt sich auch an der Fundlandschaft Österreichs ablesen. So sind aus dem heutigen Bundesland Kärnten Goldmünzen aus fünf Einzel- sowie drei Schatzfunden des 14. und 15. Jahrhunderts bekannt.
In Steinbichl (PB St. Veit an der Glan) kam ein Mainzer Goldgulden, geprägt unter Erzbischof Gerlach von Mainz (reg. 1349–1371), zum Vorschein. Aus Gmünd (PB Spittal an der Drau) stammen aus zwei unterschiedlichen Einzelfunden ein venezianischer Dukat des Dogen Antonio Venier (reg. 1382–1400), gefunden in der Stadtpfarrkirche, sowie ein ungarischer Goldgulden König Sigismunds (1387–1437). Ein weiterer ungarischer Goldgulden wurde in Steindorf am Ossiachersee (PB Feldkirchen) entdeckt; er stammt von Albrecht (V.) von Österreich (1437–1439) und wurde 1438 in Sibiu/Hermannstadt (Siebenbürgen) geprägt. Aus Semlach (PB St. Veit an der Glan) stammt ebenfalls ein ungarischer Goldgulden des Matthias Corvinus (1448–1490). In Töschling (PB Klagenfurt) wurde ein Schatzfund der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts mit 14 Goldmünzen entdeckt; darunter fünf venezianische Dukaten, zwei österreichische Goldgulden und sieben ungarische Goldgulden Ludwigs I. (1342–1382). Ein kleiner Goldhort aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts stammt aus Weißbriach (PB Hermagor). Der Fund setzt sich aus fünf Goldgulden des deutschen Raums zusammen (1x Hamburg, 1x Köln, 1x Nürnberg, 2x Heidelberg), hinzu kommen ein venezianischer Dukat sowie zwei ungarische Goldgulden Ladislaus‘ (1452–1457). Der letzte Schatzfund, entdeckt in Robesch (PB Völkermarkt), bestand aus 454 Silbermünzen und einer Goldmünze und scheint in den 1470er Jahren verborgen worden zu sein. Beim Großteil (ca. 70 %) handelt es sich um Tiroler Kreuzer, ein kleinerer Teil setzt sich aus Pfennigen des österreichisch-süddeutschen Raumes zusammen; neben wenigen venezianischen Groschen war auch ein Goldgulden des Matthias Corvinus (1458–1490) enthalten. Unter diesen 28 aus Kärntner Funden stammenden Goldmünzen macht der ungarische Anteil 46 %, also beinahe die Hälfte, aus. Diese anscheinende Dominanz der ungarischen Goldgulden mag vermutlich an der Nähe Ungarns und den intensiven Handelsbeziehungen liegen; für ein gesamtheitliches Bild wäre aber eine umfassende Fundanalyse des ostösterreichischen Raums hinsichtlich des Umlaufs von Grosch- und Goldnominalen anzudenken und die ältere Literatur dazu auf den aktuellsten Stand zu bringen – eine entsprechende Untersuchung ist am Wiener Münzkabinett angedacht.
Literaturhinweise (Auswahl)
- Michael Alram, Der Wiener Pfennig. Von Herzog Leopold V. (1177-1194) bis Kaiser Friedrich III. (1452–1493), in: 800 Jahre Münzstätte Wien, S. 53–74.
- Márton Gyöngyössy, Mediaeval Hungarian Gold Florins, Budapest 2005.
- Bernhard Koch, Goldgeld und Groschenmünze im österreichischen Geldverkehr des Mittelalters, in: Numismatische Zeitschrift 81(1965), S. 3–13.
- Bernhard Koch, Die Anfänge der Gold- und Groschenmünzen in den österreichischen Alpenländern 1250–1350, in: Numismatický sborník 12 (1971/72), S. 245–250.
- Heinz Winter / Márton Gyöngyössy, Münzen und Medaillen des ungarischen Mittelalters 1000–1526 (Sammlungskataloge des Kunsthistorischen Museums 4), Wien 2007.
Kontakt
Johannes Hartner (Kurator Mittelalter im Münzkabinett, Kunsthistorisches Museum)